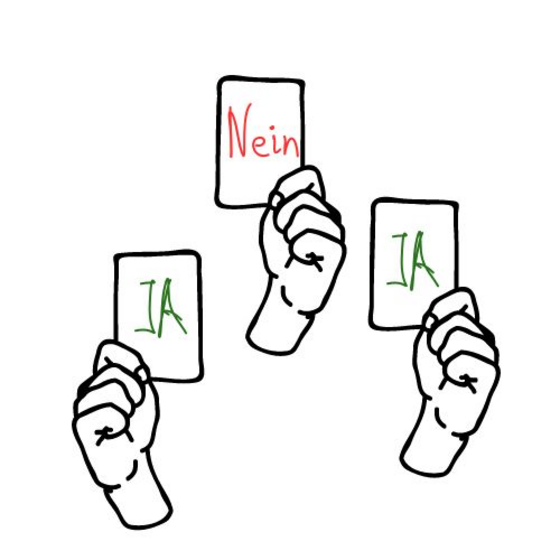Opposition
Zu den Wesensmerkmalen der freiheitlichen Demokratie westlicher Prägung gehört das verfassungsmäßig gewährleistete Recht auf Opposition. Die Ausübung dieses Rechts erfolgt zum einen in institutionalisierter Form im Kernbereich des Regierungssystems – unter „Opposition“ werden dabei in der Regel diejenigen Parteien oder politischen Kräfte verstanden, die nicht oder nur mittelbar an der Regierung beteiligt sind. Zum anderen bezieht sich der Oppositionsbegriff auf Gegenpositionen zur offiziellen Regierungspolitik, die im weiteren Kontext des politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses von Personen oder gesellschaftlichen Gruppen bezogen werden. Durch Garantien der Meinungs-, Versammlungs- und Koalitionsfreiheit verbürgt, konstituieren diese Formen jenes pluralistische Kräftespiel, das den Grundcharakter unserer liberalen Gesellschafts- und Staatsordnung umschreibt (Pluralismus).
Die nicht-institutionalisierte Opposition wurde in der Bundesrepublik lange Zeit gerne mit dem Attribut „außerparlamentarisch“ belegt. Ein Beispiel ist die sogenannte 68-Bewegung. Dies erweckt den fälschlichen Eindruck, es handele sich um prinzipiell systemfeindliche und mithin unerwünschte Gegenpositionen. Sinnvoller scheint es, solche Formen unter den weiteren Begriff der politischen Partizipation zu fassen und dort zwischen legitimen, das heißt verfassungskonformen und nicht-legitimen Spielarten zu unterscheiden. Dasselbe gilt für den institutionalisierten Bereich, wo es ebenfalls vorkommen kann, dass Parteien oder Gruppen die Grenze zur Systemfeindlichkeit überschreiten. Dies gilt zum einen – und unstreitig – für extremistische Vertreter (Extremismus), in gewissen Grenzen aber auch für den Populismus, der eine Zwischenstellung zwischen dem demokratischen und nicht-demokratischen Teil des Parteienspektrums einnimmt. Ein Gradmesser für die Zugehörigkeit zum demokratischen Spektrum ist die Bereitschaft und Fähigkeit der Parteien zur Übernahme von Regierungsverantwortung, die sie selbst für sich reklamieren oder ihnen von den anderen Parteien zugeschrieben wird.
Institutionalisierte und nicht-institutionalisierte Opposition bedingen sich gegenseitig. Je besser es den parlamentarischen Vertretern gelingt, die gesellschaftlichen Gegenpositionen zur Regierung zu repräsentieren, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese auf außerparlamentarischem Weg Bahn brechen. Eine vergleichbare Austauschbeziehung besteht innerhalb des institutionalisierten Bereichs zwischen den regierungswilligen und -unwilligen Kräften. Geben letztere ihre Verweigerungshaltung auf und werden sie von der Konkurrenz als potenzieller Koalitionspartner betrachtet, droht die Gefahr, dass andere, radikalere Kräfte in das Vakuum hineinstoßen. Ein ähnliches Dilemma entsteht, wenn die reguläre (gemäßigte) Opposition in das Regierungsgeschehen stark eingebunden ist. Dies könnte zur Vernachlässigung ihrer eigentlichen Funktionen führen, die in der Politikwissenschaft mit der Trias „Kritik, Kontrolle und Alternative“ umschrieben werden.
Formen und Funktionsweise der parlamentarischen Opposition hängen von den verfassungsrechtlichen Vorgaben und deren Umsetzung in der Verfassungspraxis ab. Für letztere ist vor allem die Entwicklung des Parteiensystems maßgeblich, dessen Struktur die Wettbewerbsbeziehungen und Regierungsformate prägen. Fasst man beide Faktoren zusammen, so kann man mit dem niederländischen Politikwissenschaftler Arend Lijphart eine Grundunterscheidung der demokratischen Regierungsformen in Mehrheits- oder Konsenssysteme vornehmen. Im Mehrheitssystem, exemplarisch vom britischen „Westminster-Modell“ verkörpert, verfügen die in der Regel nur von einer Partei gestellten Regierungen über eine weitreichende Handlungsmacht. Die Opposition ist hier ganz auf ihre Kritik- und Alternativfunktion zurückgeworfen, die sie mit dem Ziel wahrnimmt, die Regierung nach der nächsten Wahl abzulösen.
Die Konsensdemokratie orientiert sich demgegenüber am Prinzip der Machtteilung. Anstelle von Einparteienregierungen treten hier Koalitionen von zwei oder mehreren Parteien, die manchmal auch von den stärksten Kräften zusammen gebildet werden (Große Koalition). Vollständige Wechsel wie im Mehrheitssystem sind in Ausnahme, im Regelfall bleibt nach Wahlen ein Teil der Parteien im Regierungsamt. Konsenszwänge entstehen des Weiteren, wenn die Regierungsmacht von Verfassungs wegen auf mehrere staatliche Organe verteilt ist. In Deutschland ist das zum Beispiel durch die Mitwirkung des Bundesrates an der Gesetzgebung der Fall. Verfügen die Oppositionsparteien dort über eine starke Position, können sie die Regierungspolitik faktisch mitbestimmen.
Das bundesdeutsche Regierungssystem verkörperte bis Mitte der 2000er Jahre eine Mischform zwischen Mehrheits- und Konsensdemokratie. Einerseits gab es einen starken Dualismus der beiden Volksparteien Union (CDU, CSU) und SPD, die sich in der Führung der Regierung abwechselten. Andererseits mussten stets Koalitionsregierungen gebildet und die häufig abweichenden Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat beachtet werden. Bedingt durch die Entwicklung des Parteiensystems begannen sich die Gewichte danach in Richtung Konsensdemokratie zu verschieben. Das Erstarken der neu entstandenen linken und rechten Randparteien (Die Linke, AfD) zwingt seither zur Bildung lagerübergreifender Koalitionen in der Mitte, während die Funktion der Opposition jetzt zugleich von politisch radikaleren, zum Teil systemfeindlichen Kräften ausgeübt wird.
In nicht-demokratischen, autokratischen Herrschaftssystemen ist die Opposition ihrem Wesen nach systemfeindlich. Autoritäre Systeme lassen ein bestimmtes Maß an Pluralismus im gesellschaftlichen Bereich zu. Die Freiheitsrechte werden hier „nur“ im politischen Bereich beschränkt, um die Macht der herrschenden Partei oder Person zu sichern. Welcher Grad an Opposition unter welchen Bedingungen erlaubt sein soll, hängt allein von deren Willen ab. In totalitären Systemen, die den Pluralismus auch im gesellschaftlichen Bereich unterdrücken, ist der Begriff Opposition fehl am Platze. Der politische und wissenschaftliche Sprachgebrauch reflektiert das, wenn er beim Nationalsozialismus (der neben dem Stalinismus die klassische Spielart eines totalitären Systems darstellt) mit Blick auf die Regimegegner überwiegend vom Widerstand spricht, während sich bei der DDR beide Begriffe – Opposition und Widerstand – in etwa die Waage halten.
© Prof. Dr. Frank Decker (Universität Bonn)